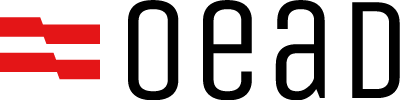Priv.-Doz. Dr. Mario Rothbauer

- 2 Besuche pro Semester
- Bevorzugte Regionen: Niederösterreich, Wien
- Bietet individuelle Besuche und thematische Workshops an
- Besucht gerne: Volksschulen, SEK I, SEK II
- Keine anfallenden Kosten für die Schule.
Forschungsschwerpunkte
- Mikrophysiologische Systeme (Organ-on-a-Chip / Joint-on-a-Chip)
- Biosensorik & Analytische Mikrosystem Technologien
- Orthopädische Biologie & Rheumatologie
- Neue Ansätze in Toxikologie & NAMs (New Approach Methodologies)
- Toxikologie (Nanotoxikologie, Neurotoxikologie, Toxiko-/Pharmakologie in der ABC-Abwehr)
Aktuelle Projekte
BodyTox 2.0: Simulation von Neurotoxin Toxizität via Hautaufnahmeroute mittels einem Body-on-a-Chip-Verfahrens: Gefährliche Chemikalien können über die Haut in den Körper gelangen und dort Schäden verursachen. Bisherige Daten zu vielen dieser Substanzen sind oft veraltet oder ungenau, weil sie hauptsächlich aus Tierversuchen stammen.
Das Projekt BodyTox 2.0 baut deshalb ein „Body-on-a-Chip“ — ein kleines Labor-Modell, das wichtige menschliche Organe wie Haut, Leber, Niere und Gehirn nachbildet. Diese Organe sind auf dem Chip miteinander verbunden, sodass auch ihre Kommunikation untereinander simuliert wird, genau wie im echten Körper. So lässt sich besser nachvollziehen, wie Schadstoffe aufgenommen, verarbeitet und zwischen Organen weitergereicht werden.
Auf dem Chip eingebaute Mikrosensoren messen die Reaktionen in Echtzeit — präzise, automatisiert und ohne Tierversuche. Das System eignet sich nicht nur zur Untersuchung besonders gefährlicher Chemikalien, sondern auch für Substanzen mit ähnlichen Wirkmechanismen (z. B. bestimmte Pestizide im europäischen Gebrauch). Dies ist angesichts der täglich neu erfundenen chemischen Stoffe, die auf uns und unsere Umwelt treffen wichtiger denn je. Dadurch kann BodyTox 2.0 helfen, bessere Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung und gezieltere Sicherheits- und Notfallstrategien zu entwickeln.
Weiche Mikroroboter für Mechanostimulation und Biosensing: Unser Körper reagiert ständig auf mechanische Signale – also auf Zug, Druck oder Bewegung. Diese Signale steuern wichtige Prozesse wie die Wundheilung oder den Aufbau von Geweben. Bis heute ist jedoch kaum bekannt, wie Zellen solche Signale genau wahrnehmen und in biologische Antworten übersetzen. Der Grund: Im Labor war es bislang fast unmöglich, Zellen gezielt und präzise mechanisch zu stimulieren und gleichzeitig ihre Reaktionen direkt zu messen.
Das Projekt SoMiCell will dieses Problem lösen. Dafür entwickeln wir winzige, lichtgesteuerte Mikroroboter, die Zellen sehr fein dosiert „ziehen“ oder „stretchen“ können. Gleichzeitig werden in diese Geräte Mini-Biosensoren eingebaut, die in Echtzeit messen, wie sich die Zellen dabei verhalten und welche Moleküle sie freisetzen.
Mit dieser neuen Technologie wollen wir insbesondere verstehen, wie fehlerhafte mechanische Signale zu Entzündungen in Sehnen- und Bändergewebe beitragen. Auf lange Sicht eröffnet SoMiCell die Möglichkeit, Erkrankungen besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln, da wir die „Sprache der Zellen“ unter mechanischer Belastung erstmals genau entschlüsseln können.
Das biomechanische Synovium: Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine chronische Gelenkserkrankung, die für Betroffene oft mit starken Schmerzen und Einschränkungen verbunden ist. Trotz moderner Medikamente spricht ein großer Teil der Patientinnen und Patienten nicht ausreichend auf die derzeitigen Therapien an. Ein Grund dafür könnte sein, dass bisherige Krankheitsmodelle bestimmte Aspekte der Erkrankung nicht realistisch abbilden – etwa spezielle Zelltypen oder die komplexen mechanischen Kräfte, die im Gelenk wirken.
Unser Projekt setzt genau hier an: Wir entwickeln ein neuartiges „Synovium-on-a-Chip“, also ein winziges Labor-Modell, das das menschliche Gelenkgewebe realitätsnah nachbildet und dabei erstmals auch die mechanischen Belastungen berücksichtigt, die in einem Gelenk natürlicherweise auftreten.
Mit diesem innovativen Ansatz wollen wir besser verstehen, warum manche Therapien bei RA versagen, und neue Wege für die Medikamentenentwicklung eröffnen. Langfristig könnte unser Modell dazu beitragen, wirksamere und individuellere Behandlungen für Patientinnen und Patienten zu entwickeln – und gleichzeitig den Einsatz von Tierversuchen deutlich verringern.
Thematischer Workshop
Wie Organ-Biochips Tierleid verhindern können
Stell dir vor, man könnte einen Mini-Menschen im Labor nachbauen – nicht als ganze Figur, sondern als kleine Bausteine wie Haut, Leber oder Herz auf einem Chip. Genau das machen Organ-Biochips: Sie sind winzige Labormodelle, die wichtige Teile des Körpers nachstellen und miteinander verbinden, damit sie wie im echten Körper zusammenarbeiten und „miteinander reden“.
Das Faszinierende: In die Chips sind winzige Sensoren eingebaut, die sofort anzeigen, wie die Zellen reagieren – zum Beispiel ob sie genug Sauerstoff bekommen oder wie viel Zucker sie verbrauchen. Mit Automatisierung können so viele Tests gleichzeitig durchgeführt werden, ganz ohne Tierversuche.
Organ-Biochips entstehen an der Grenze von Chemie, Technik, Biologie und Medizin. Chemie liefert die Materialien, Technik baut die Chips, Biologie bringt die Zellen hinein, und die Medizin nutzt die Ergebnisse für neue Therapien.
Für die Unterstufe bedeutet das: ein spannender Einblick in die „Zauberkästen“ der Forschung. Für die Oberstufe bietet es einen Ausblick, wie moderne Wissenschaft Tierleid reduzieren und gleichzeitig genauere Daten für die Gesundheit von Menschen liefern kann.
Geplant sind Einblicke mit Videos und Schaustücken und Demonstratoren, um konkret das Prinzip hinter der Technologie zu veranschaulichen.
Die Dauer des Workshops kann flexibel vereinbart werden.
-
Zielgruppe: Mittelschule, AHS (SEK 1), AHS (SEK 2), BHS, BMS, Polytechnische Schulen, Berufsschulen
-
Dauer: 2 UE
-
Ort: In Präsenz in Niederösterreich, Wien · Online in allen Bundesländern
-
Es fallen keine Fahrtkosten an.
Auszug aus dem wissenschaftlichen Werdegang
Mein akademischer Weg begann mit einem Bachelorstudium in Biomedical Engineering (2006–2009, FH Technikum Wien, mit Auszeichnung), das ich mit einer Spezialisierung in Cell & Tissue Engineering vertiefte und in einem Masterstudium in Biomedical Engineering (2010–2011, ebenfalls mit Auszeichnung) fortführte. Darauf aufbauend promovierte ich 2015 mit Auszeichnung zum Dr. nat. techn. in Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur Wien. Bereits während dieser Zeit arbeitete ich von 2011 bis 2016 als freiberuflicher Junior Researcher für Biosensor-Technologien am AIT, wodurch ich frühzeitig interdisziplinäre Expertise an der Schnittstelle von Mikro- und Biotechnologie entwickelte.
Nach der Promotion wechselte ich als PostDoc (2016–2018) in die Cell Chip Group an der TU Wien, wo ich 2018 eine Position als Senior PostDoc und Projektleiter übernahm. Parallel dazu war ich 2018–2020 als Teamleiter/Technischer Berater im Bereich Bioassays bei SAICO Biosystems KG tätig. Ab 2019 baute ich am Karl Chiari Labor für Orthopädische Biologie der Medizinischen Universität Wien die Forschungsgruppe „Orthopedic Microsystems“ auf, die ich seitdem als Gruppenleiter und Principal Investigator leite. Zudem gründete ich 2021 am Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien die Microtoxicology & NAMs Unit, die ich weiterhin als Leiter führe. Seit 2023 bin ich zudem in einer tenurierten Vollzeitposition als Deputy Lab Manager am Karl Chiari Labor tätig.
Internationale Sichtbarkeit und Vernetzung konnte ich durch mehrere Gastwissenschaftleraufenthalte unterstreichen: 2022 und 2025 am Department of Bioengineering des Imperial College London (O’Hare Group), 2023 am HSS Research Institute in New York (Otero Lab) sowie 2025 an der Chinese University of Hong Kong (Li Group). Parallel dazu nahm ich Lehraufträge an, unter anderem im Mastercurriculum Tissue Engineering & Regenerative Medicine der FH Technikum Wien.
Akademisch erreichte ich 2023 die Venia docendi in Biomedical Research (MedUni Wien) und befinde mich seit 2024 zusätzlich im Habilitationsverfahren für Toxikologie an der TU Wien. Seit Oktober 2023 bin ich zudem auf einer Tenure Track Position zur außerplanmäßigen Professur (Apl.-Prof.) an der MedUni Wien berufen. Meine pädagogische Qualifikation erweiterte ich durch das Zertifikat für Medizinische Lehre (2020–2022).
Darüber hinaus bin ich seit 2022 Young Faculty Member des FWF-Doktoratskollegs „Mature Tissue“, seit 2023 Faculty Member des Vienna Center for Engineering in Medicine (VICEM) sowie seit 2022 Vizepräsident der European Society for Alternatives to Animal Testing (EUSAAT).
Zusammenfassend zeichnet sich mein Werdegang durch den Aufbau zweier eigenständiger Forschungsgruppen, interdisziplinäre Brücken zwischen Biotechnologie, Toxikologie, Mikrofluidik und Orthopädie sowie eine klare internationale Vernetzung aus.